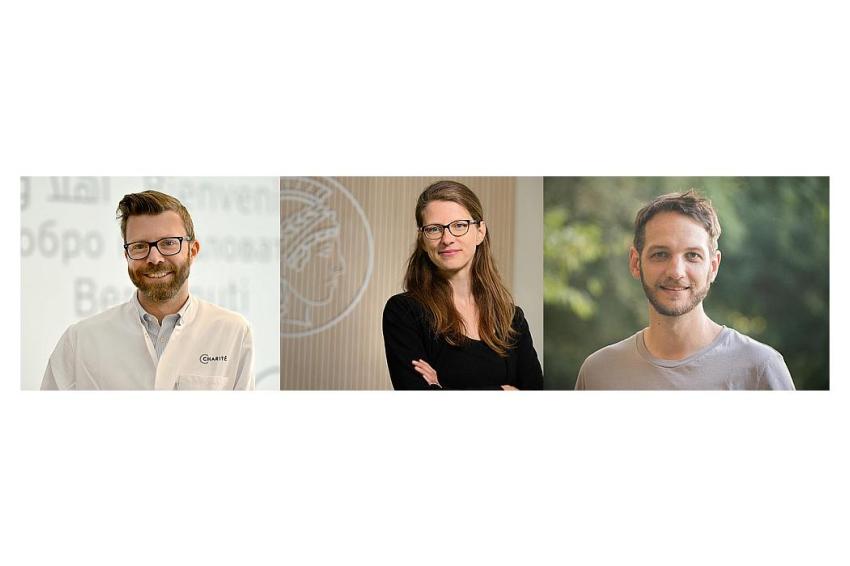ERC Starting Grants für aufstrebende Talente an Charité und BIH
04.09.2025 - Drei Nachwuchsforschende der Charité – Universitätsmedizin Berlin und des Berlin Institute of Health in der Charité (BIH) überzeugten in diesem Jahr das Auswahlgremium des Europäischen Wissenschaftsrates.
Ihre zukunftsträchtigen Vorhaben widmen sich den Selbstheilungskräften der Niere, dem ortsabhängigen Immungedächtnis und invasiven Pilzerkrankungen. Für den Aufbau eines Forschungsteams stehen ihnen in den kommenden fünf Jahren jeweils rund 1,5 Millionen Euro des European Research Council (ERC) zur Verfügung.
Visionäre und grundlagenorientierte Ideen erhalten durch die Förderung des ERC die Chance, wissenschaftlich bedeutsame Neuerungen in ihrem jeweiligen Forschungsfeld anzustoßen. PD Dr. Michael S. Balzer, Dr. Claudia Giesecke-Thiel und Dr. Johannes Hartl können ihre zukunftsweisenden Vorhaben jetzt in die Tat umsetzen.
Die Kraft der Anpassung: Wie sich die Niere selbst heilt
Eine geschädigte Niere kann sich erstaunlich gut anpassen. Wie sie das macht, weiß man bis heute nicht genau. Die subtilen Anpassungssignale gehen oft im „Lärm“ der Schädigungs- und Entzündungsreaktionen unter. Hier setzt das Projekt SINGuLAR an. Statt erkrankte Nieren zu untersuchen, erforscht der Nephrologe PD Dr. Michael S. Balzer, Forschungsgruppenleiter an der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Nephrologie und Internistische Intensivmedizin, mit seinem Team nun die gesunde Anpassung der verbleibenden einzelnen Niere nach einer Organspende. Wer eine Niere spendet, verliert dauerhaft die Hälfte seiner Nierenmasse. Allerdings wächst die verbliebene Niere funktionell über sich hinaus. „Diese Anpassung ist ein natürlicher, heilender Prozess – ganz ohne die Störsignale einer Krankheit“, sagt Dr. Balzer. „Ein ideales Modell, um echte Regenerationsmechanismen im Menschen zu erforschen.“ Mit modernsten Einzelzelltechnologien werden er und sein Team eine hochauflösende Karte der Genaktivität bei der Nierenanpassung erstellen. Die Forschenden wollen aufzeigen, wie diese Prozesse gesteuert werden, wie sie sich räumlich und zeitlich entfalten und ob sie sich therapeutisch nutzen lassen, beispielsweise um die Selbstheilung bei akuten Nierenschäden gezielt zu fördern.
Wie prägt der Ort der Infektion die Immunantwort?
Die Corona-Pandemie hat verdeutlicht, dass der Langzeit-Immunschutz im Körper nicht überall gleich organisiert ist. Während die Antikörperspiegel im Blut nach Infektion oder Impfung stabil bleiben und somit zuverlässig vor schwerer Krankheit schützen, verschwinden die Antikörper auf den Schleimhäuten der oberen Atemwege nach kurzer Zeit wieder. Dadurch wird eine symptomatische Ansteckung mit dem Virus erneut möglich. In ihrem Projekt TopBMemory will Dr. Claudia Giesecke-Thiel die zugrundeliegenden immunologischen Mechanismen genauer beleuchten. Sie erklärt: „Wie prägt der Ort des Erstkontakts mit dem Erreger die Immunantwort und das Immungedächtnis? Und wie verändert sich dieser ‚erste Eindruck', wenn der Körper später über einen anderen Weg mit dem gleichen Erreger in Kontakt kommt? Das wollen wir herausfinden." Dazu wird die Immunologin zusammen mit ihrem Team Erreger-spezifische Immunzellen im Detail durchleuchten und in Rachenmandel-Organoiden deren Funktion testen. Für das Projekt wechselt sie vom Max-Planck-Institut für molekulare Genetik (MPIMG) an die Klinik für Infektiologie und Intensivmedizin der Charité. „Langfristig wollen wir verstehen, wie sich durch eine klassische systemische Impfung ein Schutz auf den Schleimhäuten aufbauen lässt", sagt Claudia Giesecke-Thiel.
Molekulare Ursachen systemischer Pilzinfektionen
Es handelt sich um ein im Gegensatz zu bakteriellen oder viralen Infektionen wenig beachtetes, aber lebensbedrohliches Gesundheitsproblem: Pilzinfektionen, die in die Blutbahn gelangen und auf innere Organe übergreifen. Jährlich sterben weltweit mehr als 1,5 Millionen Menschen an einer solchen Infektion. Pilzinfektionen sind schwer zu diagnostizieren und nur begrenzt behandelbar. Aktuell gibt es nur wenige wirksame Medikamente. Dr. Johannes Hartl, Forschungsgruppenleiter am BIH, geht daher mit seinem Team im Projekt FungalPath der Frage nach, warum es Pilze gibt, die schwere Infektionen beim Menschen verursachen, dagegen viele nah verwandte Arten im klinischen Kontext kaum oder gar nicht auftreten. „Wir wollen molekulare Veränderungen bei Pilzen entschlüsseln, die diese für Menschen besonders gefährlich werden lassen“, erklärt Dr. Hartl. „Indem wir die Unterschiede zwischen krankmachenden und vergleichsweise harmlosen Verwandten dieser Pilze erschließen, schaffen wir die Grundlage für eine bessere Diagnostik und Behandlung.“ Das interdisziplinäre Forschungsteam nutzt modernste Technologien, insbesondere die Massenspektrometrie, um Proteine und Stoffwechselprodukte zahlreicher Pilze zu analysieren. Neben den Anpassungsstrategien der Pilze erfassen die Forschenden die Reaktionen des Wirts auf eine Infektion, um sie möglichst realitätsnah im Labor zu simulieren. Die Erkenntnisse sollen dazu beitragen, auf neue Erreger vorbereitet zu sein und Behandlungsstrategien zu entwickeln.